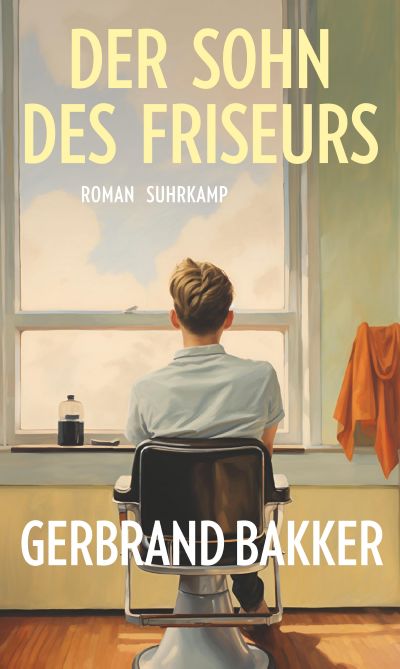Was den Briten der schwarze Humor, den Spaniern der Stolz und den Franzosen die Eloquenz ist, das ist den Niederländern ihre „typisch holländische Barschheit“. Das meint jedenfalls Gerbrand Bakker, dessen Figuren genauso knapp, direkt und fast schon ruppig miteinander umgehen wie der Erzähler über sie schreibt. Aber Klischees stimmen halt nie so richtig, und so ist es wohl unter anderem gerade diese vermeintliche Barschheit, die Bakkers Roman „Der Sohn des Friseurs“ so lesenswert macht. Hier besprochen für Ö1-Ex libris
Der Text:
Simon spricht und arbeitet nicht besonders gern, am liebsten schwimmt er und hat sonst seine Ruhe. Gestört wird diese Ruhe eines Tages jedoch durch seine Mutter Anja, die ihn um Hilfe bittet: Ihre Freundin Henny, mit der sie gemeinsam einen Schwimmkurs für Jugendliche mit Behinderung leitet, ist Hals über Kopf auf die Kanaren gereist. Simon soll aushelfen, er hat ja Zeit: Der Friseursalon in Amsterdam, den er in vierter Generation führt, ist schließlich stets geschlossen. Nur Stammkunden wissen, dass das nicht stimmt, und diese sind nicht besonders zahlreich – was dem introvertierten Simon ganz recht ist. Dass er der Sohn eines Friseurs ist, stimmt zwar, doch Vater hat er keinen, jedenfalls wenn es nach seiner Mutter geht. Die spricht lieber von einem „Erzeuger“. Kennengelernt hat Simon diesen Mann jedenfalls nie.
„Vermutlich, denkt er manchmal, wäre er nicht hier, wenn sein Vater noch leben würde. Der saß am 27. März 1977 im falschen Flugzeug. Einem falschen Flugzeug, das auf einer falschen Insel verunglückte. So wie Henny war er urplötzlich in Urlaub geflogen. Allein. Das glaubt jedenfalls Simons Mutter. Simon war noch nicht geboren, möglicherweise wusste sein Vater nicht einmal, dass er geboren werden würde. Simon kam am 4. September 1977 zur Welt, und spätestens nach dem Tod seines Vaters war es ihm vorbestimmt, Friseur zu werden. Ihm ist es recht.“
Das Flugzeugunglück, um das die Lebenswege der Figuren in Gerbrand Bakkers Roman auch Jahrzehnte später noch kreisen, hat sich tatsächlich ereignet. Ein Terroranschlag auf den Zielflughafen Gran Canaria, eine Umleitung nach Teneriffa, Kommunikationspannen, technische Probleme, sowie ein Pilotenfehler ließen am 27. März 1977 zwei Boeings auf Teneriffa kollidieren. 583 Menschen starben. Unter den Toten: Simons Vater, auch wenn sein Körper nicht identifiziert wurde und sein Name auf Wunsch von Anja auf dem in der Nähe des Flughafens Schiphol errichteten Denkmal fehlt.
Eines Tages begleitet Simon seinen bereits 88-jährigen Großvater zur Gedenkstätte. Der rüstige alte Mann macht „nicht den Eindruck, von Gefühlen überwältigt zu sein, und doch sieht Simon zum ersten Mal einen Vater, der seinen Sohn verloren hat. Der Tote ist drei Personen in einer, ein toter Ehemann, ein toter Sohn und ein toter Vater, aber der tote Vater ist ein völlig Unbekannter, für Simon hätte es jeder sein können.“
Aber warum war sein Vater überhaupt in diesem Flugzeug? Simon hat sich bisher nie für das Unglück interessiert, doch nun beginnt er nachzuforschen – wie auch einer seiner wenigen Kunden, der Schriftsteller ist und mit dem Simon, der sich auch zu einem seiner Schützlinge im Schwimmbad erotisch hingezogen fühlt, eine kurze Affäre hat.
Irgendwo in diesem sehr maskulinen Romanuniversum ist einmal von „typisch holländischer Barschheit“ die Rede. Der Ausdruck passt nicht nur auf die wortkargen Charaktere in Gerbrand Bakkers Roman, auch der Erzähler scheint sehr darauf bedacht zu sein, ja kein Wort zu viel zu verlieren. Fast könnte man seine in knappen Sätzen erzählte Geschichte über einen fehlenden Vater, eine übermächtige Mutter und einen stillen Sohn bis hierher auch ein bisschen zu schrullig, ein bisschen zu pittoresk und vielleicht sogar ein bisschen zu konventionell finden, wenn der Roman nicht plötzlich den Schauplatz wechseln und die Geschichte eines anderen Sohnes eines Friseurs erzählen würde. Ein solcher ist schließlich auch Cornelis, Simons Vater, und das ist längst nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Vater und Sohn, die einander nie kennengelernt haben. Sie teilen auch ihre Introvertiertheit, ihre Passivität und ihre Vorliebe für Männer. Cornelis ist an jenem verhängnisvollen Sonntag gar nicht so allein, wie alle glaubten, in die Unglücksmaschine gestiegen. Jacob, ein Praktikant im Friseursalon seines Vaters, war mit an Bord.
„Cornelis schaut ihn an und hat das Gefühl, einem völlig Fremden in die Augen zu sehen. Wer ist dieser Junge? Ja, er weiß, wer er ist, er weiß, dass er Jacob heißt und natürlich, dass er ein Praktikum bei seinem Vater macht, aber wieso ist er selbst, Cornelis, plötzlich zusammen mit ihm hier? […] Ihn erfasst leise Panik, er weiß nicht, was er hier eigentlich macht. Sonntagnachmittag auf einer Kanareninsel. Erst vor ein paar Stunden hat er Anja belogen, ist er davongelaufen, weil sie ihm etwas mitgeteilt hat, was viel zu groß für ihn war, ist er durch ein trostloses Amsterdam gegangen, hat er sich nach dem Einsteigen in den Bus fast willenlos forttragen lassen, hat er mit Bauchschmerzen ein Flugzeug bestiegen; […]“
Don’t cry for me Argentina läuft im Hintergrund, und Cornelis trifft an diesem Sonntag auf Teneriffa eine folgenschwere Entscheidung, um unmittelbar darauf lieber doch keine Entscheidung zu treffen. Folgenreich ist freilich auch diese, wie alles, was man tut, wenn man Sohn, Ehemann und werdender Vater ist und ein paar hundert Kilometer entfernt niemand weiß, was man gerade treibt und wo. Und so erweist sich in dem Roman, dessen Teile nicht nur die aus verschiedenen Blickwinkeln rekonstruierte Flugkatastrophe verbindet, vieles als Trugschluss. Spätestens nach dem ersten Drittel ist plötzlich nichts mehr so, wie es anfangs war, oder vielmehr: schien. Unter scheinbar harmlos dahinplätschernden Dialogen nimmt man mit einem Mal faszinierende Untiefen wahr. Die vermeintliche Simplizität der Erzählung erweist sich als raffinierte und komplexe Konstruktion, deren Teile passgenau ineinander greifen. Man entdeckt, dass alles nur scheinbar schrullig, scheinbar pittoresk und scheinbar schlicht wirkt in diesem Roman, in dem kein Wort zu viel, aber auch keines zu wenig steht, und in dem vieles offen, in der Schwebe und dadurch möglich bleibt.
Nicht einmal auf die typisch holländische Barschheit ist Verlass: Hinter dem schnoddrig-schroffen Umgangston und der irritierenden Empathielosigkeit der Figuren verbergen sich eine Zärtlichkeit, eine Sehnsucht und eine Melancholie, die auch nach der Lektüre noch lange nachklingen.