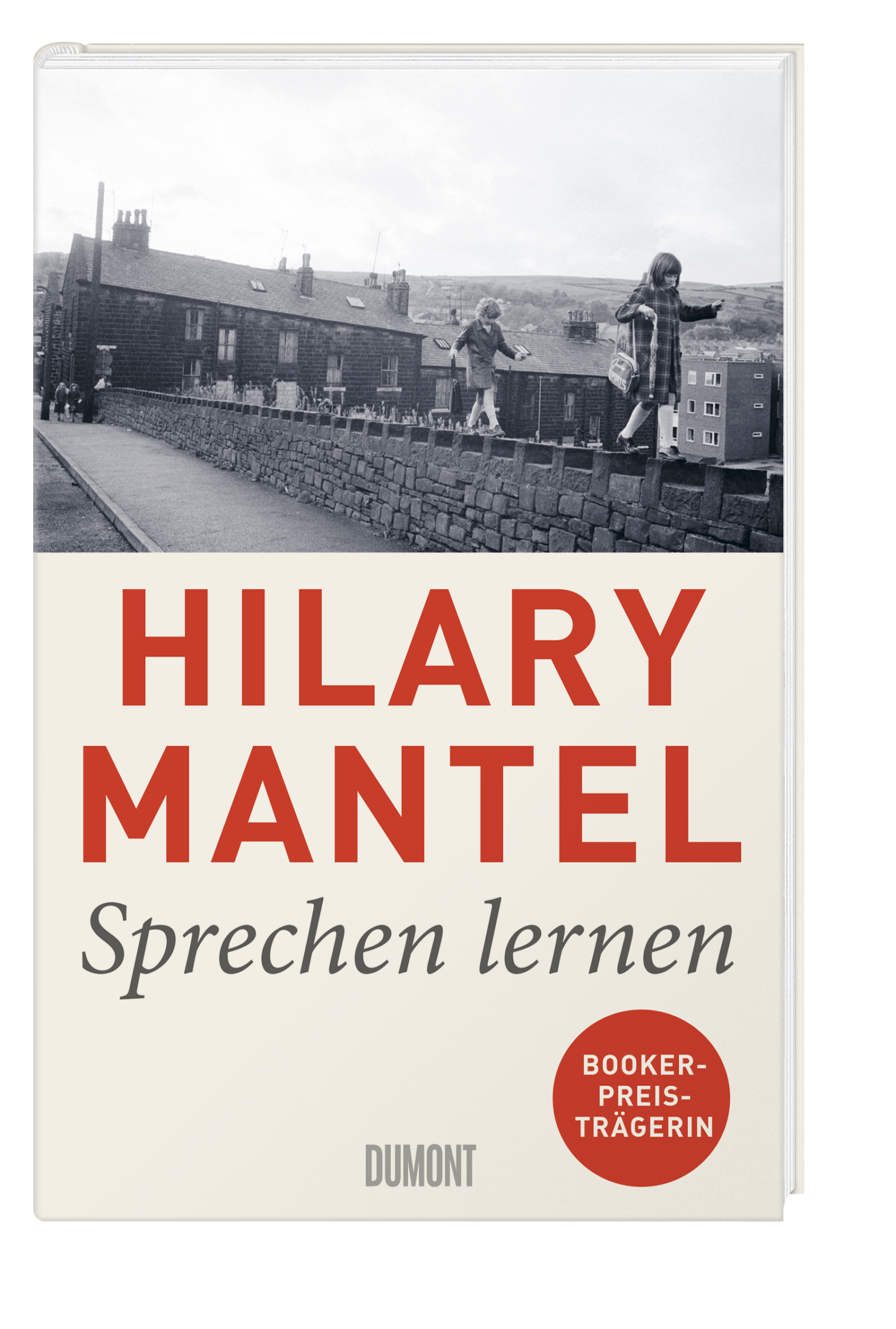Sehr lesenswert, besprochen für Ö1-Ex libris (und noch bis 24. 12. nachzuhören): Hilary Mantels Kindheitserzählungen.
Sie spielen an den Orten ihrer Kindheit, zeichnen die Etappen ihres Heranwachsens nach und haben die besondere Familienkonstellation, in der die Autorin aufwuchs, zum Thema. Dennoch möchte Hilary Mantel die Geschichten des Bandes Sprechen lernen nicht autobiografisch verstanden wissen. Viel besser würde, wie die Autorin meint, der Begriff „autoskopisch“ passen:
„Aus einer entfernten, erhöhten Perspektive blickt mein schreibendes Ich auf einen auf seine bloße Hülle reduzierten Körper, der darauf wartet, mit Sätzen gefüllt zu werden. Seine Umrisse nähern sich meinen an, aber es gibt einen verhandelbaren Halbschatten.“
Hilary Mantel, berühmt und zweimal mit dem Booker-Preis ausgezeichnet für historische Romane von epischer Wucht und Breite, hat sich für die höchstens dreißig Seiten langen Geschichten dieses autoskopischen Bandes, sechs an der Zahl, lange Zeit gelassen. „Bei King Billy ist ein Gentleman“ hatte ich innerhalb von Sekunden den ersten und den letzten Satz, brauchte aber zwölf Jahre, um den Raum dazwischen zu füllen“, so die Autorin.
Man merkt den im Original bereits vor zwanzig Jahren erschienenen Geschichten die lange Entstehungs- und Reifezeit auch an, so durchgearbeitet, dicht und präzise lesen sie sich, auch in der deutschen Übersetzung durch Werner Löcher-Lawrence, der bereits Falken sowie Spiegel und Licht übersetzt hat, den zweiten und dritten Band von Mantels Hauptwerk über Thomas Cromwell, der England zur Zeit Heinrichs VIII. reformierte.
Durch Bewusstseinsströme lässt die Autorin ihre Leser darin innerhalb weniger Zeilen tief ins 16. Jahrhundert eintauchen. Auch in den Erzählungen des vorliegenden Bandes braucht sie nur wenige Sätze, um den Ort ihres Aufwachsens vor dem inneren Auge ihrer Leser erstehen zu lassen.
„Unsere Ansammlung Stein und Schiefer, gezeichnet von rauen Winden und derben Klatschmäulern, das war nicht das ländliche England mit Morris-Tanz, gegenseitiger Verbundenheit und gutem alten Ale. Es war ein kaputter, steriler Ort ohne Bäume, wie ein Durchgangslager, mit der gleichen hoffnungslosen Dauerhaftigkeit, die solche Lager anzunehmen pflegen. Der Schnee blieb bis April in den Höhenlagen ringsum liegen.“
Hier, in einem Dorf unweit von Manchester, verbringt die Erzählerin ihre frühe Kindheit in den 1960er Jahren. Nur einige wenige Reiche verfügen über etwas, „das man Badezimmer nannte“. Die Familienkonstellation, in der das Kind aufwächst, ist für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich: Eines Tages zieht der Liebhaber der Mutter ins Haus. Mantel variiert diese Situation je nach Erzählung, wie auch das Geschlecht der Erzählerin oder eben des Erzählers von einer Geschichte zur nächsten wechseln kann. Einmal ist es ein Untermieter, der sich im Leben der Familie breitmacht, dann wieder ist von Anfang an ein Stiefvater vorhanden, oder einfach ein Mann namens Jack. Als die Mutter sie dazu verpflichtet, diesen in Gesellschaft „Papa Jack“ zu nennen, gerät die Erzählerin prompt in Lebensgefahr: Sie verirrt sich auf einem Schrottplatz und hört Jack zwar in der Ferne nach ihr rufen, kann ihm aber wegen der für sie unaussprechlichen Anrede „Papa“ nicht antworten. Als Identifikationsfiguren sind beide Väter ohnehin ungeeignet. Der eine verschwindet fast beiläufig aus dem Leben einer Familie, in der er wenig Eindruck hinterlassen hat, der andere sorgt für Angst und Schrecken. „Er war die Definition eines Mannes, wenn ein Mann denn das war, was Besorgnis verbreitete und den Frieden zerstörte.“
Dem konservativ-katholischen irischen Einwanderermilieu, in dem das Kind aufwächst, ist die Patchwork-Familie natürlich suspekt. Dennoch hat die Mutter, auch das zieht sich als Leitmotiv durch alle Erzählungen, den eisernen Willen, in eine höhere Klasse aufzusteigen.
„Als die Idee, einen Hund anzuschaffen, zum ersten Mal aufkam, sagte meine Mutter, sie wolle einen Pekinesen. Darauf sahen die Leute sie genauso an wie bei ihrer Bemerkung, zivilisierte Menschen klopften vorm Hereinkommen. Die Vorstellung, dass jemand bei uns im Dorf einen Pekinesen haben könnte, war schlicht absurd. Das wusste ich bereits. Die Leute hätten ihn gerupft und gebraten.“
Der kindliche Blick auf die von Zwängen, Verlogenheit und rücksichtslosem Kampf um die besseren Plätze geprägte Welt der Erwachsenen ist mitleidlos, sezierend scharf und voll von lakonischem Humor. Dank der fest entschlossenen Mutter gelingt der Familie der soziale Aufstieg. Nur der Akzent verrät noch das Milieu, aus dem die Erzählerin stammt, und er ist der von der Mutter festgelegten Karriere als Anwältin im Weg. In der titelgebenden Geschichte Sprechen lernen schildert die Erzählerin, wie sie schließlich eine Sprachschule besucht, um den karrierehemmenden Klang der Kindheit loszuwerden.
Die Geschichte ist ein Meisterwerk grotesker, tieftrauriger Komik, über der stets ein Satz schwebt, der schon zu Beginn fällt: „Erst später sieht man die Jahre als verloren an. Hätte es eine Jugend sein sollen, wünschte ich heute, ich hätte sie vergeuden können.“
Als Hilary Mantel ihre Geschichten vom Sprechen lernen niederschrieb, war ihre Autobiographie unter dem Titel „Von Geist und Geistern“ bereits erschienen. Den gleichen Titel trägt auch das Nachwort zu ihren fiktionalen oder eben autoskopischen Kindheitserzählungen, die sie mit etwa fünfzig Jahren vollendete. „Wenn du dich umdrehst und auf die Jahre zurückblickst, erkennst du die Geister anderer Leben, die du hättest führen können“, heißt es darin.
Begeisterte Leserinnen und Leser von Hilary Mantel werden ohnehin nicht an diesen nun endlich auf Deutsch vorliegenden Erzählungen vorbeikommen, in denen die Autorin den Blick auf ihre gelebten und einige mögliche ungelebte Kindheitsjahre richtet und so manchen der Geister aus dieser Epoche heraufbeschwört, die sie Zeit ihres Lebens heimsuchen sollten. Allen anderen sei dieser schmale und doch ungemein pralle Band voll Traurigkeit und Lebenshunger, voll Witz und Weisheit als Einstiegsdroge in das Werk der großen Erzählerin wärmstens empfohlen.