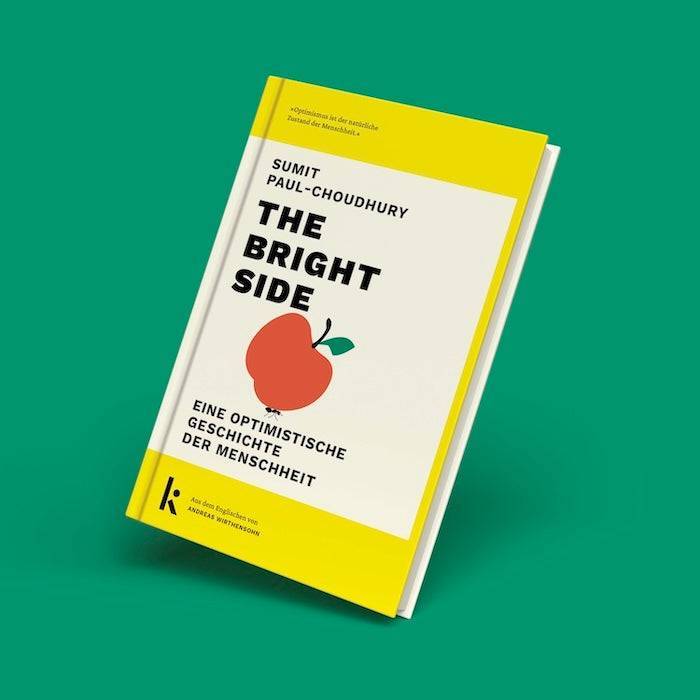Mein Beitrag zum Karfreitag 2025:
Manch eine oder einer wird beim Titel „the bright side“ unwillkürlich die Lippen spitzen, eine fröhliche Melodie pfeifen und die Schlussszene von Monty Pythons „Das Leben des Brian“ vor sich sehen, in der eine Gruppe Gekreuzigter gut gelaunt und mit den Zehen wippend „Always look on the bright side of life“ singt. Leicht könnte man dabei ein bisschen melancholisch werden: In den 1970er Jahren brachte einen die beißende Ironie womöglich noch zum Lachen – doch geht es uns mittlerweile nicht ganz ähnlich wie den Gekreuzigten? Quälen uns nicht so viele unlösbare und bedrohliche Krisen, dass jede Aufforderung, die Dinge positiv zu sehen, unweigerlich wie Hohn wirkt? Oder ist Sumit Paul-Choudhurys Buchtitel „The bright side. Eine optimistische Geschichte der Menschheit“ womöglich gar ironisch gemeint? Keineswegs, weiß Georg Renöckl nach der Lektüre.
Als seine Frau jung an Krebs starb, sah sich Sumit Paul-Choudhury gezwungen, sein Leben von Grund auf neu zu überdenken. Der langjährige Chefredakteur des New Scientist, der weltweit populärsten Wochenzeitschrift für Wissenschaft und Technologie, probierte verschiedene Lebensentwürfe aus. Nach dem Schicksalsschlag optimistisch in die Zukunft zu blicken, fiel ihm schwer. Doch auch mit Pessimismus, den er zu defensiv fand, konnte er wenig anfangen. Realismus kam ihm wiederum wie eine Ausrede vor, sich nicht mit Alternativen zum aktuellen Zustand der Welt auseinandersetzen zu müssen.
Als ich jedoch eingehender darüber nachdachte, schien mir Optimismus die einzige Haltung zu sein, die einzunehmen sich lohnte. Ich wollte eine Möglichkeit finden, Optimist zu sein, die tatsächlich dazu beiträgt, die Welt besser zu machen, anstatt nur davon auszugehen, dass sie es irgendwie schon sein würde.
Dabei stellte ich fest, dass Optimismus entgegen meinen früheren Annahmen nicht unbedingt Ausfluss von Naivität ist. Er ist eine Ressource, die wir anzapfen können, wenn es hart auf hart kommt – und dann kann er den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.
Zur Illustration erzählt Paul-Choudhury Anekdoten von Menschen, die aussichtslose Situationen dank ihres Optimismus gemeistert haben. Heute würden sich jedoch viele vor allem angesichts der Klimakrise so verhalten wie der erste von zwei Fröschen, die in einer bekannten Fabel in einem Topf mit Rahm gefangen sind: Er gibt angesichts der verzweifelten Lage auf und ertrinkt. Der zweite strampelt mit den Beinen, schlägt dadurch den Rahm zu Butter und kann hinausspringen.
Wenn wir nicht davon ausgehen, dass wir Veränderungen herbeiführen können, werden wir auch nicht in einer Weise handeln, die Veränderungen herbeiführt – was zur Folge hat, dass wir kleinlaut akzeptieren, was auch immer die Zukunft bringen mag. Optimismuslücken und Pessimismusfallen stellen eine echte Bedrohung für unsere Fähigkeit dar, die wahren und drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen.
Dabei neigen achtzig Prozent der Menschen dazu, optimistisch zu sein – solange es um sie selbst und ihr nächstes Umfeld geht. Je weniger wir das Gefühl haben, die Zukunft beeinflussen zu können, desto geringer wird der Optimismus. Vor allem auf kollektiver Ebene hat er es schwer, wie Paul-Choudhury anhand zahlreicher Bewegungen mit pessimistischer Einstellung zeigt. In einer Welt, in der Gott tot ist und die überdies in Flammen steht, könne einen eben leicht das Gefühl beschleichen, die Existenz sei sinnlos.
Ich denke, wir können es besser. Dank unserer Fähigkeit, unsere Zukunft vorauszusehen und in die Hand zu nehmen, haben wir Herausforderungen gemeistert, die jedes andere Tier sofort in die Knie gezwungen hätten. Die eigentliche Frage ist nicht, ob wir die Zukunft tatsächlich ändern können. Die Antwort darauf werden wir wohl nie erfahren. Die Frage ist, ob wir glauben, dass wir es können.
Über die Zukunft denkt die Menschheit vor allem seit der industriellen Revolution nach, da sich die Welt seither immer rasanter verändert. Paul-Choudhury nimmt seine Leser mit auf einen Parforce-Ritt durch die Literatur- und Philosophiegeschichte, die Quantenmechanik und die Mentallogik, die Neuro- und die Wirtschaftswissenschaft und zwischendurch immer wieder auch in die griechische Mythologie. Besonders hat es dem Autor Odysseus angetan. Den Erfinder des Trojanischen Pferdes zeichne eine Mischung aus Vernunft und Kreativität, Intellekt und Intuition aus, die die Menschheit auch jetzt wieder dringend brauche.
Auch unsere Reise in die Zukunft wird von Zwischenfällen und Unfällen unterbrochen; manchmal werden wir vor ihnen gewarnt, manchmal aber auch nicht. Es gibt auch nicht nur eine Zukunft. Es gibt zahllose Welten, die wir uns vorstellen können, und viele, die wir durch unser Handeln verwirklichen können. Unsere kollektive Aufgabe besteht darin, die beste dieser möglichen Welten zu finden.
Wie das gehen soll, darüber denkt Paul-Choudhury in einem Kapitel namens „praktischer Optimismus“ nach. Ist Geo-Engineering die Lösung für die Klimakrise, so wie im 19. Jahrhundert eine Ingenieursleistung die Herkulesaufgabe bewältigte, ein Kanalsystem für London zu schaffen? Der Autor weiß es nicht so recht, wie könnte er auch. Formulierungen wie „nehmen wir an“ und „es könnte sein“ prägen den letzten Teil des Buchs. Optimismus ist eben kein Werkzeug zur Lösung konkreter Probleme, sondern eher die Bereitschaft, daran zu glauben, dass ein solches Werkzeug gefunden werden kann – und das ist für den Autor eine moralische Verpflichtung.
Optimismus angesichts einer unbekannten Zukunft, die Bereitschaft, Ungewissheit zu akzeptieren und sich ihr zu stellen: Das ist wahre Zivilcourage, nicht die Passivität des „Realismus“. Wir sind es uns selbst, unseren Kindern und denen, die noch nicht geboren sind, schuldig, ins Unbekannte vorzudringen, in der Hoffnung, dort Antworten zu finden. Das ist unsere gemeinsame Pflicht: Wenn wir nicht daran glauben, dass wir unsere Probleme lösen können, werden wir sie auch nicht lösen.